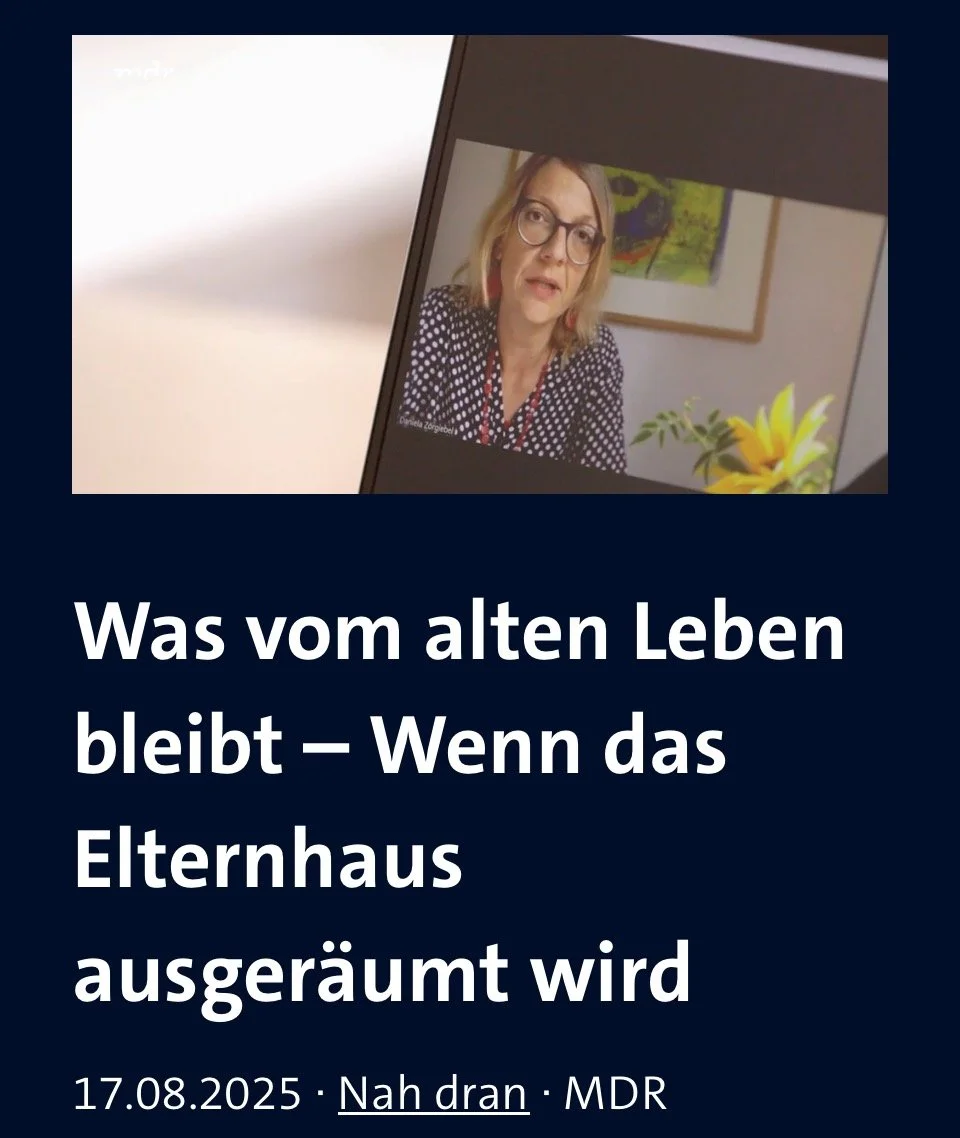Was vom alten Leben bleibt
Das Elternhaus auflösen nach einem Todesfall
Wenn ein Elternteil von uns weicht, trifft uns das meist mit unvorstellbarer Kraft. Es kommt zu Veränderungen und Auseinandersetzungen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Jede davon ist eine Herausforderung, die den Betroffenen viel abverlangt. Zahlreiche Aufgaben müssen in kurzer Zeit erledigt werden. Hinzu kommen Entscheidungen, die im Sinne der Verstorbenen zu treffen sind, wie die Beerdigung, Trauerfeier, Versorgung des Haushalts bis hin zu Haushaltsauflösungen. Gleichzeitig wiegt die Trauer schwer, denn diese Formalitäten machen den Tod des geliebten Menschen realer. Es fordert von uns etwas, was wir eigentlich nicht gerne geben wollen. Das destabilisiert und verunsichert.
Jeder Mensch erlebt den Verlust anders
Es ergibt sich innerhalb der Familie eine komplexe Dynamik und Vielfalt im Umgang mit der Trauer. Das Mobile als Metapher kann symbolhaft beschreiben, dass jeder Familienteil mit seinem Umfeld in einer Wechselwirkungsbeziehung steht. Diese Wirkungsprozesse treten nicht nur zwischen zwei Familienmitgliedern auf, sondern zwischen allen – auch in wichtigen außerfamiliären Systemen. Muss uns ein Familienangehöriger verlassen oder ein gemeinsamer Ort aufgegeben werden, müssen sich auch die anderen in Bewegung setzen, damit ein Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann.
Je nachdem, unter welchen Bedingungen eine Familie lebt, ergibt sich für jeden Einzelnen eine persönliche Stellung in der familiären Konstellation: Welche Rolle habe ich konkret in der Familie und wie handele ich daraus? Was verändert sich, wenn ich einen geliebten Elternteil verliere, oder wenn ich den Ort meiner Kindheit nicht mehr besuchen kann? Und was bleibt vom Alten? Mit dem Abschied muss das Gefüge neu organisiert und im besten Falle gemeinsam miteinander gestaltet werden.
Herausforderungen im gemeinsamen Austausch meistern
Abschiede sind emotional herausfordernd, je nach Beziehungsintensität leichter oder schwerer. Das habe ich auch beim Abschied von meinem Elternhaus erlebt. Jeder hat dabei unterschiedliche Bedürfnisse, Kapazitäten und Rollen. Das anzuerkennen und genau hinzuhören, wer was braucht, ist herausfordernd, aber diese Kraft aufzubringen lohnt sich.
Wenn sich Menschen vom Ort ihrer Kindheit verabschieden müssen, kann das verletzen. Beim Abschied vom Ort der Kindheit erleben wir tiefe Traurigkeit und einen Einschnitt in unser Leben, wenn dieser in erster Linie positiv geprägt ist. Denn wir sind mit dem Ort verbunden, den wir lieben. Der schmerzliche Verlust besteht darin, dass der Verstorbene und das Familienhaus nicht mehr da sind. Dies ist der Anfang der Trauerbegleitung.
Etwas, was geht – bleibt
Im Trauerprozess beginnen wir uns langsam und unmittelbar mit dem zu identifizieren, was nicht mehr ist. Wir setzen uns mit Gegenständen – auch der verstorbenen Person – auseinander und beginnen, bewusst wahrzunehmen, wie viel wir gemeinsam hatten. Dank dieses Ortes bin ich der Mensch, der ich bin. Das inspiriert, verbindet und bedeutet Dinge zu tun, die diesem Stück Heimat gewidmet sind. Dieser Prozess der Identifikation kann als wertschätzende Brücke gesehen werden, die Mut braucht und Neuorientierung schenkt. Eine Freude an Dingen, die mich erinnern lassen.
Es geschieht eine Umwandlung der einsamen und schmerzlichen Trauer in eine Geschichte, die dem eigenen Leben einen zusätzlichen Sinn schenkt. Damit wird das Trauererleben fruchtbar und schafft eine Beziehung zum Abschied nehmen. Etwas was geht bleibt in mir und bei mir. Der Zauber des Anfangs von etwas Neuem.
Dieser Beitrag ist gemeinsam mit Anne Kriesel, Geschäftsführerin von Bohana, zur MDR-/ RBB-Reportage “Was vom alten Leben bleibt” entstanden. In der ARD-Mediathek finden Sie weitere Informationen dazu.